

 |
 |
| Stalag VII A: Zeitzeugen |
| Bill Livingstone |


Name, Rang und SeriennummerDer kleine, aber muskulöse Wachmann der Luftwaffe mit seiner Luger an der Hüfte schob mich in eine leere Zelle. Dann fiel die schwere Holztür mit einem lauten, von den Betonwänden widerhallenden Knall ins Schloß. Dann war Stille.Die Luft in der Zelle war ganz kühl und roch muffig. Ich schätzte, daß der Raum etwa sechs Fuß breit und zehn Fuß lang war. Die Decke war ungefähr zehn Fuß über dem Boden, und beide waren aus Beton. Unter der Decke in der gegenüberliegenden Wand ließ ein quadratisches vergittertes Fenster das einzige Licht in den Raum. Durch ein kleines Loch in der Tür in Augenhöhe konnte man die Insassen vom Gang aus beobachten. An einer Wand stand eine Eisenpritsche mit einer Matratze und einer gefalteten deutschen Armeedecke. 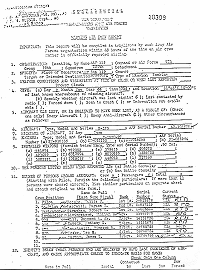
Es war Samstag der 11. November 1944, gerade neun Tage, nachdem eine FW-190 meine B-17 nahe der holländisch-deutschen Grenze abgeschossen hatte. Meine Besatzungsmitglieder und ich waren gerade in Einzelhaft genommen worden, im Verhörzentrum für Kriegsgefangene in Frankfurt in Deutschland. Der Wachmann war klein aber kräftig und hatte eine Luger-Pistole an der Hüfte. Kurz bevor ich in die Zelle eingewiesen wurde, fragte ich ihn, ob ich etwas zu essen bekommen könnte, aber er tat so, als verstünde er kein Englisch. Die Wachen verstunden sehr wohl Englisch, wie ich später feststellte, aber sie waren angewiesen, sich nicht mit den Gefangenen zu unterhalten. Als die Tür hinter mir zufiel, war mein erster Gedanke: Ich frage mich, wie lange ich wohl hier sein werde. Es war ungefähr fünf Uhr abends, und ich machte mir wirklich Gedanken ums Essen. In den letzten Tagen hatte es bestenfalls gelegentlich etwas gegeben. Ich fragte mich, warum ich in Einzelhaft saß - es war die Strafe der Wikinger, wie ich kürzlich gelesen hatte. Natürlich wollten die Deutschen meinen Willen brechen, und mich dazu bringen, daß ich ihnen alles über meine Einheit, die 95. Bombergruppe, verriet. Dann dachte ich: Naja, das wird eine gute Gelegenheit sein, mal dazusitzen und über alles nachzudenken. Also streckte ich mich auf meiner Pritsche aus, die gar nicht mal so unbequem war, schaute zu dem kleinen Fenster hinauf und sah nichts außer schiefergrauen Wolken. Es nieselte draußen, und ich schlief bald ein. Als ich mitten in der Nacht aufwachte, wunderte ich mich wo ich war. Dann begriff ich, daß ich ganz allein in dieser stillen Zelle lag. Und ich begann, an meine Leute und an Theresa daheim zu denken, eine Million Meilen von hier entfernt. Es schien alles so unwirklich zu sein. Und dann nickte ich wieder ein. Kurz nach Tagesanbruch wurde ich vom Geräusch eines Schlüssels in der Tür geweckt, die dann auch quietschend aufging. Ich sah mich um, und der Wachmann gab mir ein Zeichen, daß ich hinaus auf den Gang kommen sollte. Schon raus? dachte ich. Nein, meine Wache führte mich zur Latrine, und als ich in meine Zelle zurückkam, stand dort auf meiner Pritsche ein Napf mit einer Art Brei und einem Löffel. Der Wachmann deutete, daß ich den Napf auf den Boden bei der Tür stellen sollte, nachdem ich gegessen hatte, dann schlug er die Tür wieder zu und drehte den Schlüssel im Schloß. Durch die Tür konnte ich hören, daß er den gleichen Vorgang bei meinen Mitgefangenen im Korridor wiederholte. Der Gang zur Latrine und das Essen kamen immer ungefähr um fünf Uhr nachmittags, aber es schien mir nie genug zu essen zu geben. Nachts schlief ich, aber tagsüber gab es einfach nichts zu tun, außer ein paar Übungen zu machen. In der Zelle war rein gar nichts außer der Pritsche, meinen Kleidern und mir selber; nichts zu lesen oder zu schreiben. Am zweiten Tag fand ich zu meiner Freude heraus, daß Vincent Lauricella, mein Kamerad von der B-17, der, wie ich schon am ersten Tag merkte, in der Nachbarzelle war, mich hören konnte, wen ich nur laut genug rief. Und wenn ich mein Ohr an die Wand legte, während er schrie, konnte ich ihn gerade so hören. Beinahe das einzige, über daß wir uns "unterhielten", war das Essen. Er rief: "Ich hätte gern ein paar panierte Kalbsschnitzel und Erdbeereis zum Nachtisch." Darauf ich: "Ich nehme Steak und Eier und als Nachtisch Apfelkuchen." Irgendwie hatte ich dieses Bild eines großen T-Bone-Steak vor Augen, mit ein paar sonnengelben Spiegeleiern daneben auf dem Teller. Wir redeten auch darüber, daß es nichts zu lesen gab, aber meistens waren unsere Gespräche ziemlich langweilig. Am dritten Tag, als ich zu Vinny durch die Wand hinüberrief, öffnete die Wache meine Tür und sagte auf Deutsch, aber dennoch unmißverständlich, daß ich zu schreien aufhören sollte. Mittlerweile war ich von der ganzen Lage ziemlich angewidert, und als er die Tür wieder schloß, nutzte ich die Gelegenheit und sagte: "Fuck you." Nun stellte ich fest, daß er durchaus Englisch verstand, zumindest diese Worte, denn er kam zurück in die Zelle und fragte mich mit einem zornigen Blick, was ich gesagt hätte - jedenfalls nehme ich an, daß er das fragte. Ich wechselte schnell das Thema und sagte, daß ich ein Buch zum Lesen haben wollte, in der Hoffnung, daß das Wort "book" und das andere Wort für ihn ähnlich genug klangen, damit er mir glaubte. Er gab vor, mich nicht zu verstehen, auch nachdem ich meine Hände so hielt, als hielte ich ein Buch. Dann sagte ich, daß ich einen "Offizier" sehen wollte. Doch er beachtete das gar nicht und ging wieder aus der Zelle. Diesmal fiel die Tür wirklich mit einem Knall zu. Ich nehme an, daß Vinny die gleiche Zurechtweisung erhielt, weil wir uns nicht mehr durch die Wand unterhielten. Schon am ersten Tag stellte ich fest, daß ich mir mit dem Lösen mathematischer Aufgaben im Kopf eine Menge Zeit vertreiben konnte. Zum Beispiel rechnet ich die Entfernung von der Erde zum Mond in Fuß aus, weil ich wußte, daß es ungefähr 240.000 Meilen zum Mond waren, und eine Meile 5280 Fuß hat. Ich bin sicher, daß ich das heute nicht ohne Papier und Bleistift machen könnte, aber in der Stille der Zelle konnte ich mich völlig auf die Aufgabe konzentrieren. Ich betete auch viel, jedenfalls viel mehr als je zuvor oder danach. Ich betete, daß es Mutter, Vater, Rich und Theresa gut ging, und ich betete, daß es nie wieder Krieg geben würde. Daran dachte ich auch viel. Offensichtlich wurde nur mein erstes Gebet erhört. Diese sehr einfache Ablauf ging ohne Unterbrechung weiter bis zum vierten Tag. Ungefähr um zehn Uhr morgens öffnete der Wachmann meine Zellentür und forderte mich auf, ihm zu folgen. Er führte mich zum Ende des Ganges, durch eine verschlossene Tür, einen weiteren Gang hinunter, wieder durch eine verschlossene Tür und schließlich in einen Gang, der offenbar zu einem Amtsgebäude gehörte. Nachdem wir ein paar Türen passiert hatten, klopfte die Wache an eine von ihnen. Eine Stimme dahinter sagte: "Herein". Mein Wachmann öffnete die Tür und wies mich hinein. Ein großer Mahagonischreibtisch stand vor einem großen Fenster mit Vorhängen, durch das warmes Sonnenlicht hereinströmte. Hinter dem Tisch saß ein lächelnder Offizier der deutschen Luftwaffe, der eine makellose Uniform trug. Er war ein gut gebauter Kerl, sah überhaupt ziemlich gut aus und schien etwa 50 zu sein. Sein hellbraunes Haar war glatt zurückgekämmt. Im Vergleich mit mir war der Mann ein Filmstar, wie Paul Douglas in Naziuniform. Ich muß wie ein Penner ausgesehen haben. Ich trug einen Fünftagebart und eine zerknitterte olivgrüne Uniform, aus der ich seit dem Tag, an dem wir abgeschossen wurden, nicht mehr herausgekomen war. Als wir zuerst gefangengenommen wurden, nahmen uns die Wachen alles ab außer unserer Kleidung und einer Hundemarke. Ich hatte nicht mal einen Kamm. Aber ich war nicht um mein Aussehen besorgt, sondern ausschließlich darum, wie ich hier rauskäme. Als ich sein Büro betrat, ging er um den Schreibtisch herum, kam mit ausgestreckter Hand auf mich zu, und sagte in ausgezeichnetem Englisch: "Ah, Sergeant Livingstone, setzen Sie sich doch bitte." Er schüttelte mir fest die Hand und klopte mir väterlich auf die Schulter. Dann ging er zurück hinter den Tisch und setzte sich wieder und hatte immerzu ein freundliches Lächeln im Gesicht. Nachdem er mir eine Zigarette angeboten hatte, reichte er in eine Schublade, nahm irgendein gedrucktes Formular heraus und ergriff einen Füllhalter. Er wurde ernster, sprach aber noch immer mit freundlicher Stimme: "Sergeant Livingstone, ich muß mich für die Verhältnisse hier entschuldigen, aber ich versichere Ihnen, daß Sie mitsamt Ihrer Flugzeugbesatzung in ein sehr gemütliches Rotkreuz-Lager kommen werden, sobald wir dieses Formular ausgefüllt haben." Na, dachte ich, du hättest mich auch schon vor vier Tagen, als ich hier ankam, bitten können, daß ich dir helfe, das verdammte Formular auszufüllen. Ich erinnerte mich auch an unsere Anweisungen: Wenn ihr gefangengenommen werdet, sagt ihnen nichts außer eurem Namen, eurem Rang und eurer Seriennummer. Ich bemerkte, daß meine zweite Hundemarke auf seinem Schreibtisch lag. "Zunächst, Sergeant Livingstone, Ihren vollen Namen
bitte." Er lächelte wieder, diesmal mit einem leichten
Ausdruck von Überlegenheit: "Ist schon in Ordnung, wir
wissen, daß Sie in der 95. Bombergruppe waren."
Natürlich wußten sie das. Es stand ja in acht
Fuß großen Zahlen auf dem Schwanz unseres
"Fettarschvogels". Der Pilot der Focke-Wulff, der uns
abgeschossen hatte, mußte es auf jeden Fall gesehen
haben. Er fuhr fort, andere Fragen nach der militärischen Stärke der 95. Bombergruppe zu stellen, und mich zu warnen, daß ich in dieser sechs mal zehn Fuß großen Zelle bleiben müßte, bis ich ihm half, das Formular auszufüllen. Aber ich weigerte mich weiterhin, seine Fragen zu beantworten. Nach etwa zwanzig Minuten, drückte er schließlich einen Summer auf seinem Schreibtisch, und der Wachmann kam zurück ins Zimmer. Der Offizier sagte etwas auf Deutsch zu ihm und zeigte mir mit einer lässigen Handbewegung, daß ich der Wache hinaus und zurück zu meiner Zelle folgen sollte. Als ich gerade bei der Tür war, blieb ich stehen, drehte mich um und sagte zu dem Offizier: "Könnten Sie mir sagen, wer die Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten gewonnen hat?" Ich war am Tag nach dem Wahltag, dem 1. November 1944, abgeschossen worden, und wir hatten keine Wahlnachrichten gehört, als wir frühmorgens am 2. November zu unserem Bombenflug aufbrachen. Franklin D. Roosevelt trat gegen Thomas E. Dewey an. Er blickte von seinem Schreibtisch auf und sagte mit
einem Funken Interesse: "Roosevelt hat gewonnen." Dann kehrte das ungeduldige Stirnrunzeln zurück, und er sagte: "Wir sprechen das nächte Mal darüber." Ich bin sicher, daß er das Gefül hatte, genug Zeit mit mir verschwendet zu haben und noch eine Menge anderer Verhöre an diesem Tag vor sich hatte. Zwei Tage später wurde ich wieder zum gleichen Verhöroffizier geführt. Diesmal war er kurz angebunden. Er stellte mir all die Fragen, auf die er keine Antwort hatte, und warnte mich wieder, daß ich nicht in das "sehr nette" Gefangenenlager überstellt würde, solange ich ihm nicht half, das Formular auszufüllen. Diese Befragung dauerte nur etwa fünf Minuten. Kein Wort fiel über Präsident Roosevelt. An diesem Nachmittag wurden alle meine Besatzungskameraden und ich selber in dieses "sehr nette" Lager abtransportiert. Aber das ist eine andere Geschichte. Freitag der DreizehnteIch erinnere mich, wie ich am Freitag dem 13. April 1945 morgens aufwachte und mich fragte, ob wir wohl an diesem Tag vom Roten Kreuz etwas zu essen bekommen würden. Am Abend zuvor hatte es dieses Gerücht gegeben. Meine Muskeln schmerzten, weil ich die Nacht mit nichts weiter als einer Decke auf dem harten Bretterboden der Scheune verbracht hatte. Es hatte die ganze Nacht geregnet und die Scheune roch nach Vieh und nassem Heu. Glücklicherweise war ich trocken, weil ich einen Platz beinahe in der Mitte der Scheune hatte. Einige meiner Mitgefangenen, die nahe bei den Wänden schlafen mußten, hatten nicht so viel Glück.Etwa 2500 von uns waren jetzt acht Tage lang von Nürnberg nach Süden marschiert, und es würde noch einmal vier Tage dauern, bis wir an unserem Ziel ankommen würden, einem riesigen Kriegsgefangenenlager in Moosburg, etwa 50 Kilometer nordöstlich von München. Unsere deutschen Bewacher uns brachten nach Süden, um zu verhindern, daß wir von den vorrückenden alliierten Streitkräften befreit würden. Tagsüber marschierten wir, und die Nächte verbrachten wir in großen Scheunen, die wir in den kleinen bayerischen Bauerndörfern entlang der Route fanden. In der Nacht des 12. April 1945 schliefen wir in dem Dorf Pfeffenhausen. Als ich so auf dem Boden der Scheune saß und ein
Stück hartes deutsches Brot aß, kam einer meiner
Kameraden zu mir und fragte: "He, Livingstone, hast du
schon das neueste Gerücht gehört?" Gerüchte gehen immer um beim Militär, aber ich ich hatte ein leeres Gefühl im Bauch, und irgendwie wußte ich, daß dieses wahr war. FDR war am 8. November 1944 in seine vierte Amtszeit gewählt worden, gerade sechs Tage nachdem meine B-17 über der belgisch-deutschen Grenze abgeschossen wurde. Ich fing an, über zu Hause und meine Familie nachzudenken. Mein Vater hatte 1932 für Hoover gestimmt, aber danach hat er immer Roosevelt unterstützt. Er bewunderte den Mann aufrichtig. Mein Vater muß sich damals sehr schlecht gefühlt haben. Der Präsident war tot, und sein ältester Sohn war kriegsvermißt. An diesem Morgen marschierten wir in einem traurigen Nieselregen von Pfeffenhausen fort. Unter meinen Mitgefangenen wurde wenig geredet, als wir die matschige Landstraße entlangstapften. Wir dachten alle an den Präsidenten, und ich bin sicher, daß alle auch an ihre Lieben und zu Hause dachten. Mittags machte meine Gruppe von etwa 500 Gefangenen an einer Stelle halt, wo die Straße um einen niedrigen Hügel herumführte. Zwei Kriegsgefangene gingen den Hügel hinauf, und ich erinnere mich, daß ich ihre Rücken sah, wie sie durch das kniehohe Frühjahrsgras stapften, das die bayerische Landschaft so schön machte. Einer von ihnen trug ein Signalhorn oder eine Trompete. Es hatte zu regnen aufgehört, aber es war noch immer eine schiefergraue Wolkendecke über uns. Die kühle Luft roch nach feuchter Erde und Gras. Schließlich blieben die beiden Männer stehen und drehten sich zu uns um. Einer von ihnen war Offizier, und er sprach mit einer Stimme, die laut genug war, daß wir ihn alle hören konnten: "Mir wurde gesagt - und ich habe keinen Grund, es nicht zu glauben - das Präsident Roosevelt gestern, am 12. April, gestorben ist. Der Sergeant wird jetzt den Zapfenstreich blasen, und dann werden wir eine Schweigeminute einlegen." An diesem graugrünen Mittag hob der Sergeant sein Horn und spielte das kummervollste Trauerlied, das ich je gehört habe. Der Klang war klar und rein, und ich bin sicher, daß er meilenweit um diesen kleinen Hügel gehört werden konnte. Ich war nicht der einzige, dem Tränen über das Gesicht liefen. Als der Sergeant seinen Zapfenstreich beendet hatte, standen wir alle still mit gesenkten Köpfen da, und ich hörte das ungenierte Weinen eines Soldaten irgendwo unter uns. Dann marschierten wir weiter. FreiheitAm 29. April 1945, neun Tage bevor Deutschland kapitulierte und den Zweiten Weltkrieg in Europa beendete, ergab sich Bayern der Schönheit des Frühlings. Frisches Gras ließ die sanft gerundeten Hügel ergrünen, die die kleine Stadt Moosburg umgaben, soweit das Auge blickte.Dort im schönen Bayern grenzte Stalag VII A, ein deutsches Kriegsgefangenenlager, an das Dorf Moosburg, etwa 30 Meilen nordöstlich von München. Wir waren in dem letzten Lager, das von den vorrückenden amerikanischen Panzerdivisionen befreit werden sollte, eingesperrt. Seit mehreren Tagen hatten wir die schweren Geschütze des alliierten Vormarschs gehört und warteten schon mit großer Hoffnung auf das Ende der Gefangenschaft und den Beginn der Freiheit. Für mich hatte alles etwa sechs Monate zuvor angefangen, als eine Focke-Wulf 190 meinen B-17-Bomber über der deutsch-belgischen Grenze abschoß. Am hellichten Tag nahmen Wehrmachtsoldaten unsere Besatzung gefangen, bald nachdem wir uns in ein großes gepflügtes Feld davongemacht hatten. Nachdem wir aus einem Kriegsgefangenenlager in Nürnberg evakuiert wurden, marschierten wir schließlich Mitte April zum Moosburger Gefangenenlager. Über 50000 Gefangene oder "Kriegys", wie wir uns selber nannten, Soldaten vieler Nationalitäten, begaben sich aus ganz Deutschland, Polen und Österreich auf den "Rückzug" nach Moosburg, als sich das Naziregime seinem unabwendbaren Untergang näherte. In Moosburg lebten wir in Zelten auf matschigem Untergrund. Wir hatten nicht genug zu essen, und obwohl es genug Wasser gab, um unseren Durst zu löschen, war es sicher nicht genug, um darin zu baden. In dieser Kriegsphase kämpften die Deutschen genauso gegen die Unordnung wie gegen den Feind. Eine Woche lang hörten wir den Vormarsch von Norden, währen die deutsche Wehrmacht sich an unserem Gefangenenlager vorbei nach Süden zurückzog. Der Eintrag in meinem kleinen Tagebuch für Samstag den 28. April lautet: "Den ganzen Tag Regen, hat sozusagen Hoffnungen auf Befreiung ertränkt. Kriegys gingen nach Belieben durch das Lager, auch herein und hinaus. Verückter Krieg. Die ganze Nacht Artilleriefeuer." Der Eintrag für Sonntag den 29. April lautet: "Jede Menge Tieffliegerangriffe in der Nähe, und um elf Uhr vormittags auf Hügeln im Nordwesten Panzer von US-General Sherman gesichtet. Verbindungsflugzeug gegen Mittag über uns. Krieg geht wirklich dem Ende entgegen. Amerikanische Flagge weht um 12.45 Uhr über Moosburg. Gegen zwei Uhr nachmittags kam General Smith mit der 14. Panzerdivision der 3. Armee ins Lager. Jeder wurde verrückt. Kriegys (meistens Russen) gingen durch den Zaun und plünderten Stadt. Jeder voller K- und C-Rationen. Noch immer Granateinschläge, aber südlich vom Lager." Der Anblick dieser getarnten Panzer, die über die smaragdgrünen Hügel rollen, hat sich in mein Gedächtnis eingegraben, und die Erregung dieses Augenblicks werde ich nie vergessen. Danach spricht mein Tagebuch darüber, wie lange es dauerte, bis wir aus dem Lager und aus Deutschland wegkamen. Eine Zeile vom 6. Mai lautet: "Bin wahrscheinlich den ganzen Sommer hier, ha, ha." Wir waren zwar befreit, aber noch immer im Gefangenenlager. Der Hauptunterschied war das bessere Essen und meine siebte Dusche seit sechs Monaten. Schließlich waren wir am 8. Mai um vier Uhr früh auf den Beinen, wurden hinten auf GI-Lastwagen verstaut und rollten davon in Richtung Landshut, etwa 20 Meilen nach Nordosten. Ungefähr zehn Meilen hinter Landshut lag ein Luftwaffenstützpunkt mit einem großen Flugplatz. Nach der Ankunft wartete meine 30 Mann starke Gruppe zweieinhalb langweilige Stunden, während tausende von amerikanischen und britischen Exgefangenen in robusten alten C-47 aus Deutschland nach Le Havre in Frankreich gebracht wurden. Diese zweieinhalb Stunden schienen endlos zu dauern, aber schließlich waren wir an der Reihe. Über Deutschland abgeschossene Ex-Kriegys schworen alle, nie wieder ohne Fallschirm zu fliegen. Na ja, da wir auf diesem Flug keine Fallschirme hatten, schnallten wir uns einfach an den Aluminiumbänken an den Seiten des Flugzeugs fest. Stoßartige Gegenwinde machten den viereinhalbstündigen Flug zum rauhesten, den ich je gemacht hatte - unsere Fingerknöchel waren weiß, so sehr mußten wir uns festklammern. Nachdem wir in Le Havre gelandet waren, erfuhrenwir, daß Deutschland kapituliert hatte, während wir in der Luft waren. Was für ein großartiges Gefühl. Jetzt waren wir wirklich befreit, endlich frei. Freiheit bedeutet mehr, als sein Zuhause verlassen zu können; sie bedeutet auch, nach Hause gehen zu können. © Bill Livingstone
|
  |
|||
| Zuletzt bearbeitet am 17.4.2006 vom © WebTeam Moosburg - Es gilt das Urheberrecht! | |||